
Prof. Dr. A. A. Bispo, Dr. H. Hülskath (editores) e curadoria
científica
© 1989 by ISMPS e.V. © Internet-edição 1999 by ISMPS e.V. © 2006
nova edição by ISMPS e.V.
Todos os direitos reservados
»»» impressum -------------- »»» índice geral -------------- »»» www.brasil-europa.eu
No. 82 (2003: 2)
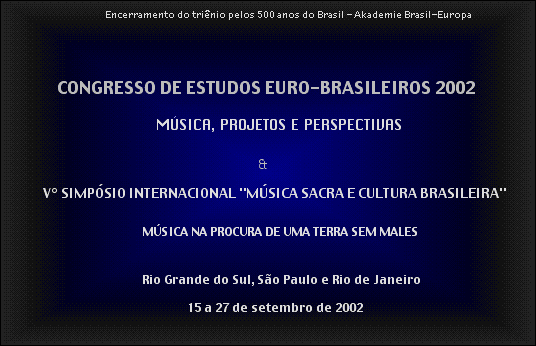 |
||||||
|
Entidades promotoras Direção geral |
||||||
|
© Foto: H. Hülskath, 2002 Archiv A.B.E.-I.S.M.P.S. |
||||||
MUSIKWISSENSCHAFTLICHE UND KULTURGESCHICHTLICHE POSITIONIERUNGEN UND NEUORIENTIERUNGEN ZUR GESCHICHTE DER AKADEMIE BRASIL-EUROPA
Eröffnugsvortrag im Kulturzentrum von Gramado
Antonio Alexandre Bispo
 Mit großer Freude sehe ich, daß ein lang vorbereitetes Projekt
heute Wirklichkeit wird: die Realisierung eines Kongresses euro-brasilianischer
Studien unter besonderer Berücksichtigung der Musik in einer Region
Brasiliens, die vielleicht am meisten eine Unternehmung dieser
Art rechtfertigt. Ich bin für diese Gelegenheit und die Gastfreundschaft
der Städte Gramado, Nova Petrópolis, São Leopoldo und Dois Irmãos
sehr dankbar.
Mit großer Freude sehe ich, daß ein lang vorbereitetes Projekt
heute Wirklichkeit wird: die Realisierung eines Kongresses euro-brasilianischer
Studien unter besonderer Berücksichtigung der Musik in einer Region
Brasiliens, die vielleicht am meisten eine Unternehmung dieser
Art rechtfertigt. Ich bin für diese Gelegenheit und die Gastfreundschaft
der Städte Gramado, Nova Petrópolis, São Leopoldo und Dois Irmãos
sehr dankbar.
Ohne das außerordentliche Engagement unserer Kollegen und Freunde
in Rio Grande do Sul wären wir heute nicht hier. Vor allem Frau
Prof. Dr. Helena Souza Nunes und Herrn Rodrigo Schramm von der
ACDG sowie ihren Helfern möchte ich im Namen aller auswärtigen
Teilnehmer unseren herzlichsten Dank aussprechen.
Ich möchte meine Rede kurz zusammenfassen. Wie läßt sich erklären,
daß wir uns in einem Kongreß euro-brasilianischer Studien, der
in verschiedenen Städten Brasiliens stattfinden wird, mit einem
musikerzieherischen Projekt, nämlich mit der Bewegung "Singe und
tanze mit uns", besonders beschäftigen, das sich in der Region
deutscher Einwanderung im Süden Brasiliens entwickelte?
*
Der Grund des besonderen Interesses der Akademie Brasil-Europa
für Probleme von kulturidentifikatorischen Prozessen und dementsprechend
auch für Unternehmungen im Bereich der angewandten Kulturforschung
und der Erziehung läßt sich aus der Geschichte der Ideale nachvollziehen,
die der Akademie zugrundeliegen. Diese vielschichtigen Denkströmungen
gehen zurück auf einen Kreis deutsch-russischer Gelehrter, die
in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in der Ukraine lebten.
Sie beschäftigten sich vor allem mit Fragen des Europäischen und
des Nicht-Europäischen in der Kultur, der Begegnung zwischen Okzident
und Orient sowie den Grundlagen abendländischer Kultur und Geistigkeit.
Es ging damals nicht nur um eine rein wissenschaftliche Beschäftigung,
sondern vor allem um Fragen der geistig-kulturellen Formung des
Menschen, d.h. im weiten Sinn um Fragen, die die Mechanismen der
Konstituierung von Kulturidentitäten betreffen und somit dem Spannungsfeld
interdisziplinärer Beziehungen zwischen Kultur- und Erziehungswissenschaft
zugeordnet werden können.
Durch die Revolution von 1917 mußten viele der Mitglieder dieses
Kreises auswandern. Sie kamen über die Krim, Istanbul und den
Balkan nach Österreich. Eine von ihnen war Tatiana Kipman, eine
Musikerin mit Interessen für die Geisteswissenschaften, die in
Salzburg Martin Braunwieser, den besten Schüler des Mozarteums
der damaligen Zeit, kennenlernte. Das Mozarteum erlebte zu dieser
Zeit unter der Leitung von Bernhard Paumgartner tiefgreifende
Reformen. Es war eine Zeit des Aufbruchs und des Wandels der Musiksprache,
der Musikanschauungen und der musikalischen Bildungsinhalte und
-methoden. Studenten und Professoren des Mozarteums gründeten
damals eine freie Akademie für Geisteswissenschaften, die sich
mit Strömungen des Denkens, der Analyse der Wirklichkeit, dem
Studium der Geschichte und der kreativ und wissenschaftlich-philosophisch
geleiteten Aktionsweisen auseinandersetzen sollte. Ein solches
Ansinnen entsprach den Bedürfnissen der Zeit, wie sie unter anderen
Vorzeichen auch in der sich damals entwickelnden Anthroposophie
und der Waldorf-Pädagogik zum Ausdruck kamen. Zu dieser Zeit wurde
zum ersten Mal das Werk "Saudades do Brasil" von Darius Milhaud
in Deutschland aufgeführt. Seitdem waren Tatiana und Martin Braunwieser
von einem Wunsch nach einem Leben in Brasilien erfüllt.
1924 wurden Mitglieder dieser Akademie geisteswissenschaftlicher
Studien nach Athen berufen, um den Musikunterricht und das Musikleben
im traditionsreichen Odeon zu erneuern. Voller Idealismus träumten
die Musiker davon, den klassischen Mo-zart-Geist Salzburgs zu
den Wurzeln der Antike zurückzuführen. So führten sie zum ersten
Mal das Requiem von Mozart im Stadion von Olympia auf. Sie haben
aber auch nicht versäumt, die "Saudades do Brasil" in Griechenland
vorzustellen. 1928 wanderten diese Musiker nach Brasilien aus,
nämlich zu der Region São Paulos, in der unser Studienzentrum
liegt. Sie begannen dort eine Arbeit der Erneuerung des Musiklebens
und des Musikunterrichts. So waren sie diejenigen, die Béla Bartók
und P. Hindemith in Brasilien eingeführt haben. Ihre Tätigkeit
mußte aus sprachlichen Gründen naturgemäß zunächst in deutschsprachigen
und russischen Kreisen ansetzen,was aber bald eine erstaunliche
Dynamik entfachte, durch die sprachliche, kulturelle und soziale
Grenzen sowie historisch bedingte Kontexte überwunden werden konnten,
was für die historisch orientierten kulturwissenschaftlichen Studien
heute von größtem Interesse erscheint. Von Anfang an standen Fragen
der Rolle der Musik bei der Kulturformung sowie der Musikerziehung
und -pädagogik im Vordergrund.
Während Tatiana Kipman sich so z.B. der Pflege des Kunstliedes
in deutscher Sprache widmete, versuchte Braunwieser, deutsche
Kirchenlieder der portugiesischen Sprache anzupassen. Die Hauptaufmerksamkeit
galt jedoch den Kindern. In Zusammenarbeit mit dem staatlichen
Rundfunksender für Kultur São Paulos schuf er so bereits 1930
ein musikalisches Hörspiel für Kinder.
Unter der Leitung von Martin Braunwieser wurde das deutschsprachige
Musikleben São Paulos von Grund auf erneuert. Darüber hinaus förderte
er bemerkenswerterweise die Entwicklung des Gesanges in portugiesischer
Sprache. Da er mit der Bewegung des Volkschores im deutschsprachigen
Raum vertraut war, unterstützte er z.B. nach Kräften die Entstehung
des Volkschores in portugiesischer Sprache in Brasilien. Zusammen
mit dem Schriftsteller Mário de Andrade veranstaltete er 1937
den I. Brasilianischen Kongreß der gesungenen Nationalsprache.
1938 nahm er als Musikforscher an der wichtigen Expedition für
Musikforschung zum Nordosten Brasiliens teil. Die Eindrücke, die
er bei dieser Reise gewann, prägten zutiefst seine weitere Arbeit.
M. Braunwieser erkannte in den Volksspielen und -tänzen des Nordostens
Brasiliens das Weiterleben von uralten Kulturerscheinungen und
spürt in ihnen die Wirkung einer symbolischen Organisation des
Weltbildes auf, die der Kultur Brasiliens zugrundelag. Ihm lag
daran, diese erkannten Sinnbilder auch für die Musikerziehung
anderer Regionen Brasiliens in reflektierten Auseinandersetzungen
fruchtbar werden zu lassen, um kulturellen Entfremdungen in den
kosmopolitischen Städten vorzubeugen und zugleich den sich damals
ausbreitenden Tendenzen einer nationalistischen Reduktion des
Kulturverständnisses und des Sinnes schöpferischer und pädagogischer
Kulturarbeit entgegenzuwirken.
Gelegenheit zur Anwendung dieser Erkenntnisse ergaben sich durch
die Entwicklung eines Netzes von Kindergärten in São Paulo, in
denen Kinder der verschiedensten Immigrantenkreise sozialisiert
und erzogen werden sollten. Dies war ein offizielles Experiment
der Stadt São Paulo, das in seiner Art Pioniercharakter in Lateinamerika
hatte. Bereits für die erste Vorstellung dieser Kinder schuf Braunwieser
ein Musiktheater, das sich auf das Motiv des Waldes und der Indianer
bezog. Das Paradigma der musikalischen Arbeit war jedoch das Spiel
des Katharinetenschiffes bzw. der Barke, das auch als Seefahrerspiel
oder Adventsspiel bekannt ist und zur Weihnachtszeit im Nordosten
traditionell aufgeführt wird.
In diesem Volksspiel erkannte M. Braunwieser das Weiterleben eines
uralten Symbols für Vorstellungen, die die Formung des Menschen
betrafen und die Überlegungen der Akademie für geisteswissenschaftliche
Studien in Salzburg und Athen geprägt hatten. Diese Darstellungen
vermittelten seiner Ansicht nach in spielerischer und lustiger
Weise durch Tanz und Musik die Auffassung, daß das Leben mit einer
Schiffsreise vergleichbar sei. Wie bei einer Seefahrt erleiden
wir auf unserem Lebensweg Stürme, und Kämpfe unter der Reisegefährten
können verhindern, daß wir glücklich das ersehnte Ziel, den Hafen,
erreichen. Das Wichtigste bei diesem Abenteuer ist der Wind, der
zwar ein schnelles Vorankommen ermöglichen, jedoch auch Wellenberge
auftürmen kann, die das Schiff gefährden. Bei diesen Gelegenheiten
zeigen sich die Weisheit des Kapitäns, die richtige Orientierung
des Spähers auf der Höhe des Mastes und die gemeinsame Mitarbeit
der Mannschaft.
Der Wind betrifft im metaphorischen Sinn die Musik des geistigen
Lebens der Gesellschaft, zu der wir gehören, unseren sozio-kulturellen
Körper. Der pädagogische Sinn dieses Bildes liegt nach M. Braunwieser
darin, den Kindern zu zeigen, daß wir uns auf unserer Lebensreise
weiterhin nach den Fixsternen orientieren, d.h. stets durch höhere
ethische Werte und Kategorien leiten lassen müsen. Damit gewährleisten
wir, daß auch unter unseren Reisegefährten z.B. Friede und Harmonie
herrschen , da durch die Vorherrschaft des mentalen Lebens das
Leben der Arbeit nicht zu einer Sklaverei wird. So werden nach
diesem Spiel wundersam Windstillen überwunden und die Wellen beruhigt,
und wir können unsere Reise friedlich fortsetzen. In metaphorischem
Sinn tragen wir damit zum Frieden der uns umgebenden Welt bei.
In mythologischer Deutung stellt diese Barke das Schiff der Argonauten
dar, in biblischem Sinn die Arche Noah. Dieses Bild wurde von
- vor allem deutschen - Jesuiten in der Barockzeit dazu verwendet,
außereuropäische Völker neu zu formen. Es stellt einen der zentralen
Gegenstände der Überlegungen bei dem mit unserem Kongreß gleichzeitig
stattfindenden Symposium "Kirchenmusik und Brasilianische Kultur"
dar, da dieses unter dem Motto "Musik auf der Suche nach einem
Land ohne Bösem" steht, was sich auf die Geschichte der Sintflut
und somit die Arche Noah bezieht.
Wie sie feststellen können, hat unser Kongreß euro-brasilianischer
Studien zwar kultur- und wissenschaftstheoretische Zielsetzungen,
kann jedoch bei seinen Diskussionen keinesfalls musikerzieherische
und -pädagogische Dimensionen außer Acht lassen, da wir uns mit
Fragen der Konstituierung von Kulturidentitäten, ihre Dynamik
und Wandlungen sowie mit der Rolle sozialer Netzwerke in der Entwicklung
von Denkströmungen und Methoden in der Kultur- und insbesondere
in der Musikwissenschaft beschäftigen werden.
Dies sind eben Ziele der Akademie Brasil-Europa für Kultur- und
Wissenschaftsforschung, eine Organisation, die die Ansätze von
Martin Braunwieser in ständigen wissenschaftlichstheoretischen
Reflexionen, in globaler Zusammenarbeit von Vertretern verschiedener
Disziplinen und in der Auseinandersetzung mit anderen theoretischen
und methologischen Konzepten kritisch weiterentwickelt und aktualisiert.
Er war nicht nur ein Musikforscher, sondern eine der wichtigsten
Gestalten der vielschichtigen Geschichte der Musikpädagogik und
des Einsatzes der Musik in der Kulturarbeit Brasiliens, nämlich
beim sogenannten Orpheonischen Gesang. Deshalb sind wir besonders
dankbar, diese Tage des Zusammenseins mit der Bewegung "Cante
e Dance com a Gente" in den Städten deutscher Einwanderung des
Staates Rio Grande do Sul verbringen zu dürfen.
[…]
Da publicação:/Aus der Veröffentlichung:
Musik, Projekte und Perspektiven. A.A. Bispo u. H. Hülskath (Hgg.).
In: Anais de Ciência Musical - Akademie Brasil-Europa für Kultur-
und Wissenschaftswissenschaft. Köln: I.S.M.P.S. e.V., 2003.
(376 páginas/Seiten, só em alemão/nur auf deutsch)
ISBN 3-934520-03-0
Pedidos com reembolso antecipado dos custos de produção e envio
(32,00 Euro)
Bestellungen bei Vorauszahlung der Herstellungs- und Versandkosten
(32,00 Euro):
ismps@ismps.de
Deutsche Bank Köln (BLZ 37070024). Kto-Nr. 2037661
Todos os direitos reservados. Reimpressão ou utilização total
ou parcial apenas com a permissão dos autores dos respectivos
textos.
Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck und Wiedergabe in jeder Form
oder Benutzung für Vorträge, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung
der Autoren der jeweiligen Texte.